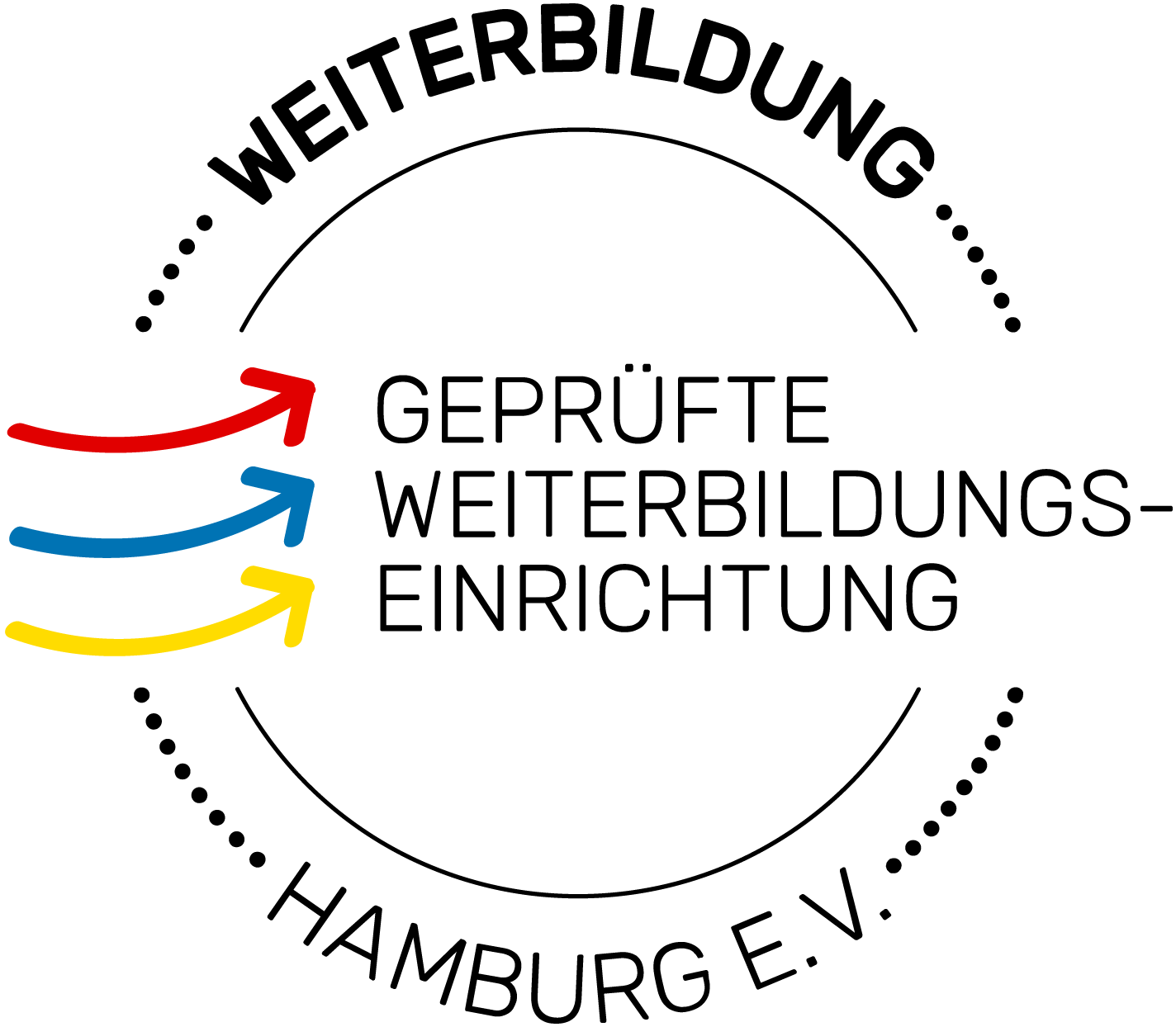Tibet
Tibet - bedrohte Hochkultur
Tibet ist das größte Hochland der Erde. Umgeben von den Bergmassiven des Himalaja, die im Süden 8000 Meter sowie im Osten und Westen 6000 Meter überschreiten, liegt das besiedelte Hochplateau auf einer Höhe von 3600 bis 5200 Metern. Mit 2,5 Millionen Quadratkilometern erstreckt sich Tibet über eine Fläche, die sieben Mal so groß ist wie Deutschland.
Mit dem tibetischen König Songtsen Gampo gelangte ab dem 7. Jahrhundert der Buddhismus aus Indien nach Tibet. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich eine Hochkultur, die auf dem indischen Buddhismus basierte und auch die umliegenden Länder wie die Mongolei und Bhutan beeinflusste. Besonders Merkmal der tibetisch-buddhistischen Kultur ist die Betonung von Mitgefühl, Gewaltlosigkeit und Weisheit.
Politisch isolierte sich Tibet Jahrhunderte lang vom Rest der Welt und verschloss sich modernen Entwicklungen wie der Industrialisierung, Demokratisierung und Wissenschaft. Die Regierung hatte es verpasst, 1945 einen Aufnahmeantrag in die Vereinten Nationen zu stellen. Die Neuordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg ging völlig an den Tibetern vorbei.
Das Interregnum zwischen dem Tod des 13. Dalai Lama und dem Herrschaftsantritt des 14. Dalai Lama war durch eine Isolationspolitik nach außen und eine korrupte Politik im Innern gekennzeichnet. Sozialreformen, die der 13. Dalai Lama angestoßen hatte, wurden zurückgenommen.
Die Politik des Mittleren Weges
S.H. der Dalai Lama, der 1959 aufgrund der chinesischen Besatzung aus seiner Heimat Tibet fliehen musste, konstituierte 1960 im indischen Dharamsala die Regierung Tibets im Exil. Seither setzt sich der Friedensnobelpreisträger für Verhandlungen mit der chinesischen Regierung zur Lösung des Tibetproblems ein.
Im Juni 1988 legte er vor dem Europaparlament seinen als „Straßburger Vorschlag“ bekannten Plan vor, für welchen er in der Folge im Jahr 1989 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Demnach sollte Tibet zu einer Friedenszone werden, echte Autonomie erhalten, aber im chinesischen Staatsverband bleiben. Der Dalai Lama verzichtete mit diesem „Mittleren Weg“ erstmals auf die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Tibets.
Als Antwort verkündet die chinesische Regierung im September 1988 ihre Bereitschaft, mit den Tibetern zu verhandeln, zog aber schon zwei Monate später ihr Angebot zurück und lehnte den Straßburger Vorschlag ab. Nach friedlichen Demonstrationen für die Unabhängigkeit Tibets in Lhasa verhing Peking im März 1989 das Kriegsrecht über die tibetische Hauptstadt, das bis zum Frühjahr 1990 in Kraft blieb.
Im Juni 1992 reiste der Bruder des Dalai Lama, Gyalo Thondup, auf Einladung von chinesischen Regierungsstellen zu Gesprächen nach China. Diese blieben jedoch bei ihrer ablehnenden Haltung und brachen 1993 alle offiziellen Kontakte zu tibetischer Vertretern ab. Der Dalai Lama betonte weiterhin seine Bereitschaft zu Gesprächen.
Erst 2002 kam es zur Wiederaufnahme offizieller Kontakte zwischen der chinesischen und tibetischen Führung. Der Dalai Lama ernannte Kelsang Gyaltsen und Lodi Gyari zu seinen Sondergesandten. Dieses reisten im September 2002 nach China und Tibet. Es war das erste Gespräch hochrangiger Diplomaten seit 1993, das von chinesischer Seite jedoch als „privat“ tituliert wurde. Es folgten weitere Gespräche, das für lange Zeit letzte fand auf Druck der internationalen Gemeinschaft nach den großen Unruhen in ganz Tibet im März 2008 dann im Oktober 2008 in Peking statt.
Dabei hatte die chinesische Seite darauf gedrängt, dass die tibetische Exilregierung einen Plan vorlegt, wie sie sich die tibetische Autonomie vorstellt. Im Oktober legten die Gesandten einen detaillierten Plan vor. Kurz nach dem Ende der Gespräche erklärte der chinesische Verhandlungsführer die Gespräche für gescheitert.
Im Frühjahr 2011 zog sich der Dalai Lama von allen politischen Ämtern in der Exilregierung zurück und legte die politischen Geschicke ganz in die Hand der demokratischen Institutionen.